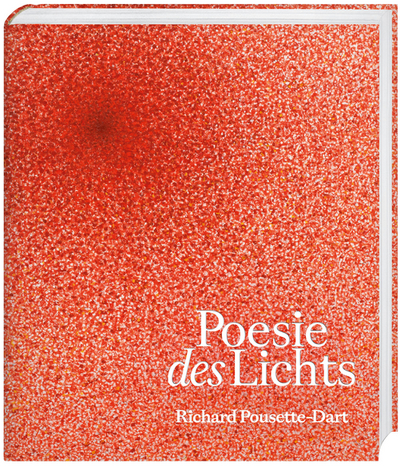Dies ist der gleichnamige Katalog zur Ausstellung "Monets Küste - Die Entdeckung von Étretat" die vom 19.3.2026–5.7.2026 im Staedel Museum in Frankfurt/Main gezeigt wird.
Um sich einen Überblick über das zu verschaffen, was im vorliegenden Buch gezeigt und sehr gut erklärt wird, ist es sinnvoll, neben dem Vorwort von Sylvie Ramond, der Chefkuratorin, Generaldirektorin der Kunstmuseen MBA/MAC, Direktorin des Musée des Beaux –Arts de Lyon und Philippe Demandt (Direktor, Städel Museum, Frankfurt am Main) und der umfangreichen Einleitung, der Autoren Stéphane Paccoud, Isolde Pludermacher und Alexander Eiling, die 12 Seiten umfassende Chronologie, zu Ende des Werks zu studieren. Hier auch findet man Verweise zu Abbildungen und Werken, die in der Ausstellung und im Katalog zu sehen sind.
Auf die Ausstellung im Staedel Museum in Frankfurt bin ich jetzt schon neugierig, nicht zuletzt. weil ich während meiner Studienzeit 2 x in Étretat in der Normandie war und von daher weiß, weshalb Dichter, Schriftsteller und Maler sich in diesen Ort hemmungslos verliebten. Ähnlich wie St. Paul de Vence im Süden Frankreichs, verfügt Étretat über einen ganz besonderen Charme, der für Künstler über die Zeiten hinweg eine sprudelnde Inspirationsquelle gewesen ist.
Im 1. Teil der Einleitung referiert Stéphane Paccoud über "Die Romantik und die Erfindung Étretats". Hier liest man, dass die erste bekannte Darstellung dieses Fischdorfes aus der Zeit um 1786 stammt. Es handelt sich um ein Aquarell des Malers Alexandre Jean Noel. Man liest weiter von Normandie-Reisenden nach der Französischen Revolution, deren Interesse allerdings mittelalterlichen Kunstwerken gegolten habe.
Bislang betrachte man den Künstler Eugène Isabey als Entdecker von Étretat. Man liest übrigens von einer ganzen Reihe von Malern der "Romantischen Schule", die der Faszination besagten Ortes erlegen waren.
Teil 2, verfasst von Isolde Pludermacher, befasst sich mit dem pittoresken Ort an sich und der Tatsache, dass Künstler dort sogar niederließen. Den Anfang nahm 1849 Le Poittevin, der eine Künstlerkolonie gründete. Die Anziehungskraft des Ortes soll auch Käufer und potentielle Sammler angezogen haben.
Man liest von zahlreichen bekannten Malern und Schriftsteller, auch Musikern wie Jaques Offenbach, der dort eine Villa erbauen ließ, in der sich einer der größten und schönsten Salons des Künstlerortes befunden haben soll. Neben den Steilklippen seien die Künstler selbst immer mehr Wahrzeichen von Étretat geworden.
Im dritten Teil der Einleitung, sie ist von Alexander Eiling verfasst, wird der Ort von Monet bis Matisse abgehandelt, also Impressionismus und Postimpressionismus. Man erfährt, was Monet motivierte, nach Étretat zu gehen. Der Wunsch nach unberührter Natur nach dem 1870/71er Krieg bei den Käufern scheint ein wichtiger Grund gewesen zu sein. Zwischen 1883 und 1886 hielt Monet sich jedes Jahr in dem Fischerdorf auf und schuf 80 Werke.
Um 1900 kamen weitere Künstler nach Étretat und es ging auch danach so weiter. So hat Henri Matisse 1920 allein 40 Gemälde und zahlreiche Zeichnungen dort geschaffen.
Ab Mitte des 20. Jahrhunderts sei die künstlerische Auseinandersetzung mit Étretat abgeebbt. Einer der wenigen zeitgenössischen Künstler sei der Düsseldorfer Fotograf Eger Esser, der im Jahr 2000 eine 15 teilige Serie großformatiger Landschaftsfotografien schuf.
In der Folge lernt man die Künstler Eugène Isabey und Eugène Delacroix in Texten von Stéphane Paccoud kennen und kann sich in deren Werke vertiefen, die in den "Mythos Étretat" einstimmen und speziell mit "Der Steilküste von Étretat" von Delacroix für Neugierde sorgen, weil man mit einem Geheimnis konfrontiert wird, konkret, dem der Ausstrahlung dieser Küste. Was empfindet man beim Betrachten oder besser Bestaunen?
Dann folgen verschiedene Essays, die dem Leser Étretat immer näher bringen und diverse Kurzporträts der Maler, deren Gemälde man kennenlernt. Wie Étretat im 19. Jahrhundert ins Bild gesetzt wurde, berichtet Pierre Wat. Hier auch liest man, dass Victor Hugo andeutete, dass die Klippe von Étretat ein Monster der Natur sei. Spannend, sich in Hugos Zeichnungen zu vertiefen, die aus seinem Reisetagebuch stammen.
Werke des deutschen Landschaftsmalers Johann Wilhelm Schirmer lernt man kennen. Die Ausstellung zeigt übrigens rund 170 herausragende Gemälde, Zeichnungen, Fotografien sowie historische Dokumente, unter ihnen 24 Werke von Claude Monet.
Sie vereine neben Werken von Eugène Delacroix, Gustave Courbet, Claude Monet und Henri Matisse eine Vielzahl weiterer Positionen der modernen und zeitgenössischen Kunst – von Eugène Le Poittevin über Camille Corot, Gustave Caillebotte und Johann Wilhelm Schirmer bis hin zu Elger Esser. Beeindruckend!
Über das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Welten in Étretat erfährt man Wissenswertes, so auch über die Wäscherinnen am Strand des Ortes.
Der Künstler Hugue Merle wird textlich sehr gut vorgestellt, auch über die Badegäste, Sommerfrischler und Touristen im 19. Jahrhundert erfährt man Näheres, kann sich an Plakaten erfreuen und Gemälden von Eugene La Poittevin über das Seebad Étretat. Auch alte Fotografien sind ein Thema, auf denen Felsen und Wellen die Protagonisten sind.
Nach einer sehr guten Präsentation von Gustave Courbet in Étretat und dessen dortigem Schaffen wird man mit Monet und Étretat vertraut gemacht. Alexander Eiling schreibt hier auch über Monets 1868/69 in Étretat entstandenes Gemälde "Das Mittagessen", das im Katalog zu sehen ist und über die entstandenen Werke von 1885/86 und hier speziell die Erkundung wechselnder Lichtstimmungen. Eine Fülle wunderschöner Gemälde der Felsformation- d’Amont, der Porte d’Aval und der Manneporte darf man bestaunen. Unter dem Eindruck der sich stets verändernden Licht- und Wetterverhältnisse begann Monet in Étretat erstmals, Motivreihen zu malen. Diese Arbeitsweise sollte sich später zu seinem Markenzeichen entwickeln.
Was dann noch folgt, ist eine auch textlich gelungene Präsentation der Schweizer Malerin Sophie Schaeppi mit ihren Werken von Étretat, Gemälde von Felix Vallotton werden zudem gezeigt und schließlich wird Wissenswertes zu Henri Matisse im Sommer 1920 in Étretat vermittelt. Auch hier wunderbare Gemälde und schließlich Informationen darüber wie - speziell durch Maupassant und Flaubert - die Steilklippen von Étretat Einzug in die Literatur gehalten haben. Fotos von Elger Esser runden den Reigen der visuellen Eindrücke ab.
Was bleibt, ist der Wunsch die Ausstellung im kommenden Jahr in Frankfurt zu besuchen und zuvor immer wieder Vorfreude aufgrund der Texte und Bilder des Katalogs zu entwickeln.
Maximal empfehlenswert
Helga König
Onlinebestellung; Hirmer oder überall im Fachhandel erhältlich